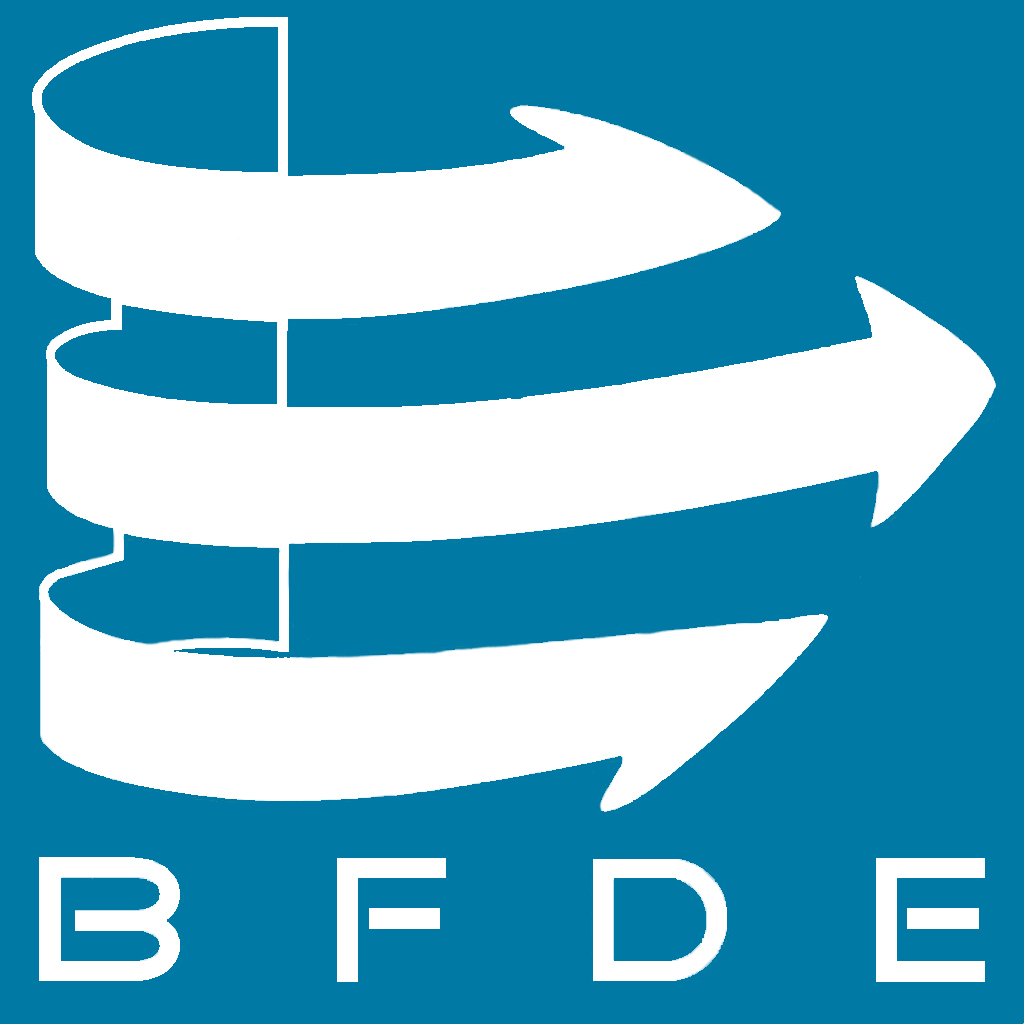Die Agora Energiewende hat heute ein Impulspapier zum Problem des Direktvertriebs von EEG-Strom veröffentlicht. Das BFDE begrüßt ausdrücklich, dass dieses Thema auf diese Weise aufgegriffen und grundsätzlich erörtert wird.
Gegenwärtig kann nach dem EEG geförderter Ökostrom nicht direkt an Verbraucher geliefert werden, obwohl hiernach eine immer größere Nachfrage besteht. Mitglieder einer Energiegenossenschaft beispielsweise, die vor Ort ein Solarkraftwerk betreibt, stehen regelmäßig vor der Frage, warum sie den sauberen Strom, den sie produzieren, nicht auch bei sich zu Hause beziehen können. Stattdessen sind sie auf den Bezug von Strom angewiesen, dessen Herkunft nicht näher nachgewiesen werden kann, oder aber sie beziehen Strom aus einer erneuerbaren Altanlage, die keine EEG-Förderung (mehr) erhält und zu der in der Regel kein örtlicher Bezug besteht.
Der Unterschied zwischen EEG-Strom, den alle Stromkunden in einer Art Gesellschaftsprojekt fördern, und Ökostrom, den Stromkunden darüber hinaus freiwillig von den Stromvertrieben beziehen können, ist in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Dass der Bezug von Ökostrom hinsichtlich des Ausbaus erneuerbarer Energien völlig wirkungslos sein kann – gerade so als ob konventioneller Strom gekauft würde – diese Erkenntnis ist noch weniger verbreitet. Ein Unding, dass der Rechtsrahmen dies so vorsieht.
Regelrecht absurd wird es bei der Kennzeichnung der Stromherkunft, die – gesetzlich vorgeschrieben – in jeder Stromrechnung enthalten ist. Denn obwohl manche Stromversorger zur Belieferung ihrer Kunden 100 Prozent Ökostrom z.B. aus bayerischer Wasserkraft einkaufen, müssen sie einen fiktiven Anteil EEG-Stroms auf der Rechnung ausweisen. Dass darüber hinaus die Stromvertriebe unterschiedliche EEG-Stromanteile ausweisen müssen, obwohl gemäß EEG-Logik alle Stromverbraucher zu gleichen Anteilen den Erneuerbare-Ausbau bezahlen, muss den Stromkunden vollends verwirren.
Es wäre sehr zu begrüßen, wenn – wie angekündigt – spätestens mit der nächsten EEG-Novelle die Grundlagen dafür geschaffen würden, EEG-geförderten Strom anlagescharf an Endkunden zu vermarkten. Insbesondere ein lokaler bz. regionaler Ökostromvertrieb sollte möglich sein, insbesondere wenn dieser lastgangscharf Erzeugung und Verbrauch synchronisiert und damit dem Gestaltungsprinzip dezentraler Systemoptimierung folgt.
In der Zwischenzeit unterstützt das BFDE seine Kunden dabei, bereits unter den gegebenen Rahmenbedingungen das Maximum aus ihrem Erneuerbare-Portfolio herauszuholen.
Heute endet die Frist zur Erstellung von Energieaudits. Nach dem Energiedienstleistungsgesetz müssen alle Unternehmen, die nicht als KMU eingestuft werden, eine solche Überprüfung ihrer Energieversorgung bis spätestens heute durchgeführt haben. KMU heißt: mehr als 250 Mitarbeiter oder mehr als 50 Mio. Euro Umsatz bzw. 43 Mio. Jahresbilanzsumme. Das klingt nach viel, doch es sind tatsächlich sehr viele Unternehmen betroffen, denn auch Unternehmensverflechtungen werden bei der Ermittlung der o.g. Kennzahlen umfassend berücksichtigt.
Es ist schon länger bekannt, dass bei weitem nicht alle verpflichteten Unternehmen den Energieaudit bis zum heutigen Stichtag bereits werden durchgeführt haben. Auch ist durchgesickert, dass die Prüfbehörden wohl noch einige Monate Kulanz bei der Stichbeprobung walten lassen werden. Bei wem der Energieaudit tatsächlich noch aussteht, der sollte jetzt aber rasch handeln.
Ein Gedanke hier zu: warum die Auditverpflichtung nicht zum Anlass nehmen, gleich ein umfassendes Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO 50001 einzuführen. Auch hiermit können die gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden. In einem ersten Schritt hat hierfür die Geschäftsführung lediglich zu erklären, dass sie ein solches System einführen will und zudem eine erste Energiedatenerfassung durchzuführen.
Das BFDE unterstützt seine Kunden hierbei sowie bei den internen Audits und der Managementreview, um nicht nur bestmöglich für die Zertifizierung vorbereitet zu sein, sondern aus den so erhobenen Daten und Informationen auch konkrete Handlungsoptionen abzuleiten und auch konkrete Energiewendekativitäten fachlich aufzusetzen und zu begleiten, um Energie zu sparen bzw. nachhaltig zu erzeugen und dauerhaft Kosten zu sparen. Sprechen Sie mit uns.
Im Rahmen der „Heim und Handwerk“, Messe München, hat das BFDE heute die Ergebnisse eines Konzepts für die Energieversorgung sechs baugleicher Einfamilienhäuser in Baldham vorgestellt. Das Konzept sieht vor, die Gebäude mit Wärmepumpen zu beheizen, die Umweltwärme aus einer zentralen Grundwasserbohrung beziehen. Der Strom für den Wärmepumpenbetrieb (sowie den Haushaltsbedarf) wird zu großen Teilen durch Photovoltaik-Eigenerzeugung gedeckt. Ein modernes Steuerungs- und Regelungssystem übernimmt die Koordination von Stromerzeugung, -speicherung und -nutzung und bindet auch Ladestationen für die Elektromobilität ein.
Gut 100 Mietsparteien werden ab sofort in einem Münchner Mehrfamilienhaus mit Strom versorgt, der direkt im Gebäude erzeugt wird. Zweier Quellen wird sich hier bedient, nämlich eines Blockheizkraftwerks zu gemeinsamen Erzeugung von Wärme und Strom sowie einer Photovoltaik-Anlage zur Stromproduktion auf dem Gebäudedach. Die Stromversorgung der Mieter dieses weitgehend energieautonomen Gebäudes ist erheblich kostengünstiger als bei herkömmlicher Netzversorgung.
Die Mieterstromversorgung übernimmt der Ökoenergieversorger Polarstern. Das BFDE hat in dessen Auftrag das energiewirtschaftliche Konzept entwickelt und Polarstern zudem bei der Umsetzung unterstützt.
Damit eine so umfassende Mieterstromversorgung erfolgreich gestaltet werden kann, müssen
- BHKW- und PV-Anlage optimal aufeinander abgestimmt sein,
- die Anschlüsse ans öffentliche Netz anders als sonst gestaltet werden,
- die verschiedenen Stromflüsse im Gebäude durch geeignete Zähler erfasst werden,
- die stromwirtschaftlichen Prozesse im Hintergrund (Strombeschaffung, Netzbetrieb etc.) angepasst,
- die korrekte Abrechnung der Stromlieferung unter Berücksichtigung der jeweiligen Nebenkostenbelastung der einzelnen Stromflüsse sowie den Vorgaben hinsichtlich zu erbringender Stromherkunftsnachweise sichergestellt sowie
- die Schnittstellen zwischen den einzelnen Beteiligten (Gebäudeeigentümer, Anlagenbetreiber, Energieversorger, Mieter) abgestimmt werden.
Das BFDE hat die Partner des Münchner Projekts gezielt unterstützt, diese Aspekte zu einem stimmigen Ganzen zusammenzufügen.
Eine Pressemitteilung ist hier nachzulesen.
Seit etwa einer Woche liegt der Entwurf des sog. Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende vor. Was da im Wesentlichen geregelt wird, ist die für die nächste Zukunft geplante, sukzessive Umstellung auf Strommesssysteme, die auch im Bereich der kleineren Verbraucher nicht nur z.B. jährliche Verbrauchssummen, sondern Zeitreihendaten erfassen, die eine z.B. minutenscharfe Aufschlüsselung des Stromverbrauchs ermöglichen.
Zu unterscheiden sind hier die reinen Zählereinheiten, die „Smart Meter“, von einem übergeordneten Kommunikationssystem zwischen Versorger und Verbraucher – das „Smart Metering System“, in welches diese eingebunden sind. Erst letzteres ermöglicht die schon seit längerer Zeit beschworenen und schlechterdings unter gegenwärtigen Rahmenbedingungen nicht möglichen, an Knappheitssituationen im Großhandelsmarkt angepassten „variablen Stromtarife“.
Die aktuellen Gesetzgebungsaktivitäten haben eine Reihe von Veränderungsthemen für freie und grundzuständige Messstellenbetreiber, Stromversorger, Hersteller von Stromanlagen und viele andere Energiewendeakteure im Gefolge. Das BFDE berät seine Kunden auf diesem aktuellen Felde umfassend durch Wissensvermittlung und Gutachten, Strategieberatung und Geschäftsmodellentwicklung.
Das Bundeskabinett hat gestern den vom Bundeswirtschaftsministerium ausgearbeiteten Entwurf für ein neues Kraft-Wärme-Kopplung-Gesetz beschlossen. Die Gesetzesnovelle bringt eine Reihe fundamentaler Änderungen. So wird die Förderung der KWK-Stromerzeugung eng an die Einspeisung des Stroms in öffentliche Netze gekoppelt. Ausnahmen hierzu gibt es (fast) nur im Bereich der kleinen KWK.
Diese Ausgestaltung ist logische Folge der grundlegenden Systementscheidungen, die im Zuge der aktuellen Gesetzgebungsaktivitäten rund um den Strommarkt 2.0 federführend vom Bundeswirtschaftsministerium angestrengt worden sind. Das System, das demnach entstehen soll, ist streng zentralistisch und auf ein zentrales Preissignal hin – den Börsenstrompreis – ausgelegt. So sollen auch KWK-Anlagen zukünftig vermehrt dann Strom erzeugen und ins Netz einspeisen, wenn der am zentralen Handelsmarkt gebildete Strompreis Knappheit anzeigt.
Grundsätzlich sinnvoll, lässt sich an diesem Prinzip aber auch Kritik festmachen. Denn während der angestrebte zentrale Preisbildungsmechanismus effizient für zeitliche Synchronität von Erzeugung und Verbrauch von Strom sorgt, ist er für räumliche Synchronität blind. Nur aber wenn Erzeugung und Verbrauch auch – als Gestaltungsprinzip – räumlich zueinandergeführt werden, kann der Bedarf an Übertragungsnetzen auf ein Minimalmaß reduziert werden. Ein systemdienlich gestalteter, d.h. Residuallastgradienten minimierender Eigenverbrauch wäre ein solches – konkurrierendes – Gestaltungsprinzip dezentraler Steuerung. Im EEG vor wenigen Jahren noch konkret verfolgt, stellt sich die aktuelle Gesetzgebung diesbezüglich diametral anders dar.
Nach langem Prozess mit Grün- und Weißbuch und mehrstufigen Akteursanhörungen ist vergangene Woche der Referentenentwurf des sog. Strommarktgesetzes veröffentlicht worden. Ein Artikelgesetz, umfangreich und komplex, durchaus an manchen Stellen mit Überraschungen und – wie immer – „Vorhang zu und alle Fragen offen“.
Das grundsätzliche Gestaltungsprinzip ist eine freie zentrale Preisbildung bei möglichst unverfälschter Weitergabe von Knappheitssignalen und Selbstheilung der Marktkräfte. Ein Lehrstück angewandter Wirtschaftstheorie. Aber wie passt das zusammen mit den Anfordernissen der leitungsgebundenen Stromversorgung, wie kann tatsächlich dem Idealbild vollständiger Information und Freiheit von Preisverzerrung nahegekommen werden und wie sinnvoll ist die kontrafaktische Annahme jederzeitiger Verfügbarkeit gehandelter Strommengen an allen Netzanschlusspunkten des Bundesgebiets, die nur zum Preis des umfänglichen Netzausbaus und erheblicher Re-Dispatch-Maßnahmen aufrechtzuerhalten ist?
Das Reformpaket „Neues Strommarktdesign“ hat nicht weniger vor als eine Anpassung der Netzentgeltsystematik und Regelleistungssystematik, eine Stärkung der Bilanzkreisverantwortung, die Einführung einer Kapazitätsreserve und eine Überarbeitung der gesamten Systemdienstleistungsbereitstellung. Weitere, vom Gesetzentwurf konkret adressierte Stichpunkte (Auswahl) sind: Spitzenkappung von EEG-Strom, Informationsrechte von Netzbetreibern, Monitoring der Versorgungssicherheit, Netzreserve für neu zu errichtende Erzeugungsanlagen in Höhe von 2 GW, Wegfall vermiedener Netznutzungsentgelte.
Hinsichtlich der konkreten Umsetzung bleiben in vielen Bereichen – fast zwangsläufig möchte man sagen – noch Fragezeichen. Man darf davon ausgehen, dass im Gesetzgebungsverfahren eine Vielzahl von Regelungen weiter konkretisiert, manche wegfallen und weitere hinzukommen werden.
Für alle Energiemarktakteure sind diese Entwicklungen naturgemäß von größter Bedeutung. Es wird so gut wie kein Geschäftsmodell geben, das hiervon nicht betroffen ist. Und man denke erst an die Vielzahl an Geschäftsmodell, die der neue Rechtsrahmen erst ermöglichen wird! Wohl dem, der hier Informationsvorsprünge hat, Vorsprünge in der Bewertung, Ableitung und Anwendung für bestehende und künftige Produkte und Dienstleistungen. Das BFDE unterstützt seine Kunden in diesem aktuellen Veränderungsprozess umfassend durch Wissensvermittlung, Gutachten, Studien, Strategieberatung, Geschäftsfeld- und Geschäftsmodellentwicklungen.
Das BFDE hält in den den nächsten acht Wochen eine Reihe von Fachseminaren zum Thema „Energiewende verstehen: Wie der Energiemarkt gegen den Strich gebürstet wird“ ab. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die aktuellen Änderungsdynamiken, die wesentlichen Hintergründe, Chancen, Risiken und Hindernisse der Energiewende in Deutschland. Wie die Energiemärkte gegenwärtig organisiert sind, wie die Energiewende diese Organisation verändert, warum herkömmliche Energielösungen und Geschäftsmodelle nicht mehrzeitgemäß sind und andere noch nicht funktionieren, wird ausführlich erläutert und diskutiert.
Die Veranstaltungen sind bereits ausgebucht. Weitere folgen und werden u.a. in diesem Blog rechtzeitig angekündigt.
Nachdem das Bundeswirtschaftsministerium bereits im Oktober des vergangenen Jahres in einem Grünbuch die Weichen für die künftige Gestaltung des Strommarkts gestellt hatte, blieb noch eine systementscheidende Frage offen. Wenngleich die Präferenz des Ministeriums deutlich herauszulesen war, eröffnete das Grünbuch eine Grundsatzdebatte über die Weiterentwicklung des bestehenden sog. Energy-Only-Markts oder die Einführung sog. Kapazitätsmärkte. Beide Varianten stehen in einem Entweder-Oder-Verhältnis zueinander.
Im gestern veröffentlichten Weißbuch spricht sich das BMWi nun – absehbar – klar gegen Kapazitätsmärkte aus. In die Erstellung des Textes seien ca. 700 Stellungnahmen von Verbände, Behörden, Verbänden, Gewerkschaften, Unternehmen und Bürgern eingegangen. Er definiert drei wesentliche Säulen, auf denen das künftige Strommarktdesign aufruhen soll: 1 Stärkere Marktmechanismen, 2 flexible und effiziente Stromversorgung und 3 zusätzliche Absicherung.
Entscheidendes Gestaltungsprinzip des sog. Strommarkt 2.0 ist die konsequente Ausrichtung auf einen zentralen Preisbildungsmechanismus, dessen Knappheitssignale künftig möglichst unverfälscht bei den Erzeugern und Verbrauchern von Strom ankommen sollen. Dahin, dass diese Preiswirkung wirklich entfaltet werden kann, ist es aber noch ein ausgesprochen langer Weg, der eine umfassende Revision der gesamten Stromnebenkostensystematik erfordert.
Der vorgeschlagene Strommarkt 2.0 soll eine möglichst effiziente zeitliche Synchronität von Erzeugung und Verbrauch sicherstellen. Hinsichtlich räumlicher Synchronität ist er allerdings blind. Das heißt, der Marktmechanismus unterstellt (schon heute teilweise kontrafaktisch) die Verfügbarkeit einer gehandelten Strommenge an allen Anschlussstellen an das öffentliche Stromnetz.
Anstelle eines Kapazitätsmarkts soll künftig eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen garantieren, dass die Stromversorgung auch bei weiter stark steigenden Anteilen fluktuierend einspeisender Erneuerbarer stets gewährleistet ist. Die wichtigste wird die sog. Kapazitätsreserve sein. Hier werden außerhalb des Marktgeschehens stehende Kraftwerkskapazitäten vorgehalten, die im Falle ausbleibender Markträumung einspringen sollen. Diese Reserve ist nicht zu verwechseln mit der bereits bestehenden Netzreserve, die sog. Re-Dispatch-Maßnahmen zur Behebung von Netzengpasssituationen dient, wenn die o.g. Annahme steter ubiquitärer Verfügbarkeit der Handelsmengen nicht zutrifft und entsprechend netzsteuernd eingegriffen werden muss.
Aus dem Weißbuch wird in nächster Zukunft eine Reihe von Gesetzes- und Verordnungsnovellen hervorgehen, dein ihrer Summe zu einer erheblichen Veränderung der Spielregeln auf dem Strommarkt führen werden.
Das BFDE hat in Krailling die Eignung der Abwasserwärme zur Wärmeversorgung eines größeren Wohnquartiers untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass diese Wärmequelle und der Bedarf des Quartiers nicht zueinander passen. Die Versorgung zweier benachbarter Neubauten erscheint hingegen grundsätzlich möglich. Eine wirtschaftlich vertretbare Lösung wird allerdings aller Voraussicht nach nicht ohne großzügige Förderung zu haben sein.
Abwasserkanäle führen Wasser mit vergleichsweise hohen Temperaturen, auch im Winter. Diese Wärmequelle kann zur effizienten und ökologisch hochwertigen Beheizung von Gebäuden genutzt werden. Dazu wird die Temperatur des Abwassers mit Hilfe einer Wärmepumpe auf das benötigte Niveau angehoben.
Abwasser-Wärmepumpen können ausgesprochen effizient arbeiten. So ist es beispielsweise möglich, mit einer Einheit Strom fünf Einheiten Wärme zu erzeugen. Wird der Wärmepumpenstrom nachhaltig erzeugt – was in steigendem Maße geschieht – kann von höchsteffizienter erneuerbarer Wärmeerzeugung gesprochen werden. Herkömmliche Kesselheizungen – auch solche, die mit Biomasse betrieben werden – können aus einer Einheit Brennstoff maximal eine Einheit Wärme herausholen. Wärmepumpen, die eine entsprechend hochwertige Umweltwärmequelle anzapfen, erfüllen demnach berühmtem Faktor Fünf, um den die Energieeffizienz mit bereits heute verfügbarer Technologie erhöht werden kann.
Zur Untersuchung des BFDE ist heute folgender Artikel im Münchner Merkur erschienen:
MM-15-05-21-Machbarkeitsstudie-zur-Nutzung-von-Abwasserwärme-in-Krailling