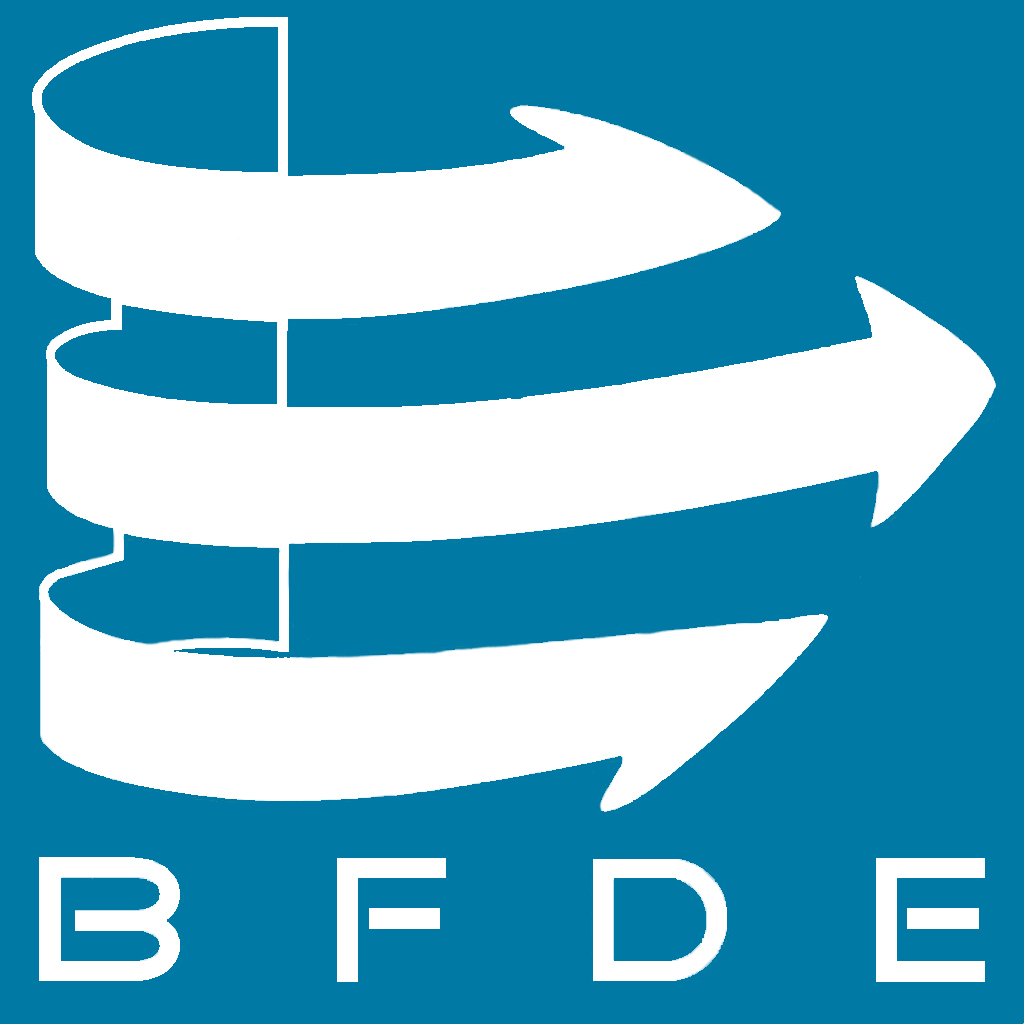Das Bundeskabinett hat gestern den vom Bundeswirtschaftsministerium ausgearbeiteten Entwurf für ein neues Kraft-Wärme-Kopplung-Gesetz beschlossen. Die Gesetzesnovelle bringt eine Reihe fundamentaler Änderungen. So wird die Förderung der KWK-Stromerzeugung eng an die Einspeisung des Stroms in öffentliche Netze gekoppelt. Ausnahmen hierzu gibt es (fast) nur im Bereich der kleinen KWK.
Diese Ausgestaltung ist logische Folge der grundlegenden Systementscheidungen, die im Zuge der aktuellen Gesetzgebungsaktivitäten rund um den Strommarkt 2.0 federführend vom Bundeswirtschaftsministerium angestrengt worden sind. Das System, das demnach entstehen soll, ist streng zentralistisch und auf ein zentrales Preissignal hin – den Börsenstrompreis – ausgelegt. So sollen auch KWK-Anlagen zukünftig vermehrt dann Strom erzeugen und ins Netz einspeisen, wenn der am zentralen Handelsmarkt gebildete Strompreis Knappheit anzeigt.
Grundsätzlich sinnvoll, lässt sich an diesem Prinzip aber auch Kritik festmachen. Denn während der angestrebte zentrale Preisbildungsmechanismus effizient für zeitliche Synchronität von Erzeugung und Verbrauch von Strom sorgt, ist er für räumliche Synchronität blind. Nur aber wenn Erzeugung und Verbrauch auch – als Gestaltungsprinzip – räumlich zueinandergeführt werden, kann der Bedarf an Übertragungsnetzen auf ein Minimalmaß reduziert werden. Ein systemdienlich gestalteter, d.h. Residuallastgradienten minimierender Eigenverbrauch wäre ein solches – konkurrierendes – Gestaltungsprinzip dezentraler Steuerung. Im EEG vor wenigen Jahren noch konkret verfolgt, stellt sich die aktuelle Gesetzgebung diesbezüglich diametral anders dar.